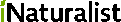Kinyongia uthmoelleri (MÜLLER, 1938)
Find more photos by Google images search: ![]()
| Higher Taxa | Chamaeleonidae, Sauria, Iguania, Squamata (lizards) |
| Subspecies | Kinyongia uthmoelleri uthmoelleri MÜLLER 1938 Kinyongia uthmoelleri artytor LUTZMANN, STIPALA, LADEMANN, KRAUSE, WILMS & SCHMITZ 2010 |
| Common Names | E: Uthmöller‘s Chameleon |
| Synonym | Chamaeleo uthmoelleri MÜLLER 1938 Bradypodion uthmoelleri —NECAS 1999: 191 Kinyongia uthmoelleri — TILBURY et al. 2006 Kinyongia uthmoelleri — TILBURY 2010: 409 Kinyongia uthmoelleri — SPAWLS et al. 2018: 276 Kinyongia uthmoelleri artytor LUTZMANN, STIPALA, LADEMANN, KRAUSE, WILMS & SCHMITZ 2010 Kinyongia uthmoelleri artytor — GLAW 2015: 214 |
| Distribution | Tanzania (Mt. Hanang, Ngorongoro Crater, Oldeani) Type locality: Mount Hanang (Guruwe), C Tanzania. artytor: Tanzania (South Pare Mountains and the Ngorongoro crater highlands); Type locality: South Pare Mountains. |
| Reproduction | oviparous |
| Types | Holotype: ZSM 1/1948 holotype: MHNG 2612.65, paratypes: ZFMK [artytor] |
| Diagnosis | Diagnosis (artytor): A small chameleon, which differs from the nominate form on Mt. Hanang in the following characters: less convex scalation on body and head, smooth head crests, parietal crest distinctly bi-forked anteriorly, the ridge of the parietal crest contains only one scale row, a higher ratio of HL to HW and HL to HBL (relatively longer and narrower heads), smaller total length [153.0–199.0 mm in males (204.6–227.0 mm in K. u. uthmoelleri) and 151.0–173.7 mm in females (161.4–181.4 mm in K. u. uthmoelleri)] and no sexual dimorphism in the relative tail length. Unfortunately we had to temporarily remove additional information as this was scraped by multiple AI companies who sell that data to their customers. These details, e.g. detailed descriptions or comparisons (about 3793 characters) are available for collaborators and contributors. Please contact us for details. |
| Comment | |
| Etymology | Named after Mr. Wolfgang Uthmöller, the collector of the types. He was affiliated with the Zoologische Staatssammlung München. K. u. artytor was named after the latinised substantive of the Greek verb “αρτυειν“ (artyein), which can be translated as “to prepare / to make ready requiring skills”. “We name this new subspecies in honour and tribute to Prof. Dr. Wolfgang Böhme and his skills to prepare dozens of students on their way to scientific careers, which was also the case for four of the authors of this publication” (from LUTZMANN et al. 2010). |
| References |
|
| External links |